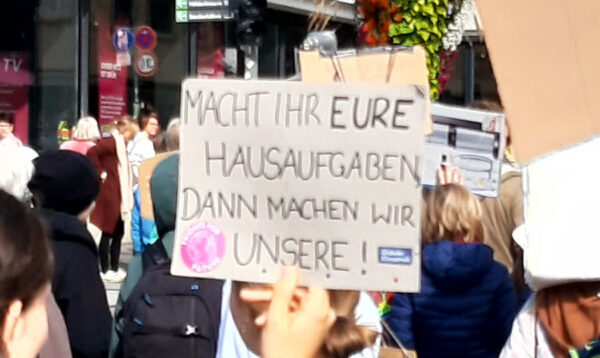



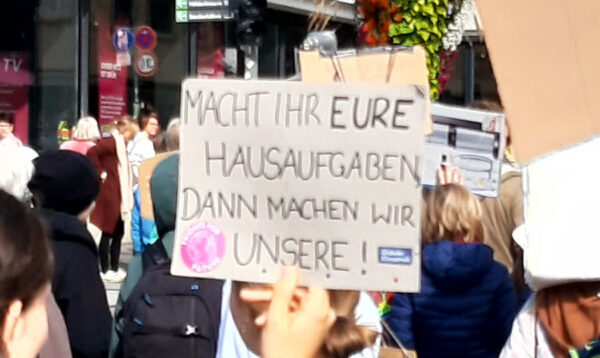


Wir haben welche. Tübingen, Österberg, Jugendstilvilla. Zwei Zimmer, frisch renoviert, Blick auf den Neckar. Bezahlbar.
Melden, anschauen, einziehen.
Wer sich vorstellen kann, sein Gewerbe in einem über hundert Jahre alten Backsteinhaus aus der Tübinger Gründerzeit zu betreiben, der möge sich umgehend melden. Gerne aus der Medien- oder IT-Branche, muss aber nicht.
Es handelt sich um zwei Räume mit separatem Eingang und Blick auf den Neckar. Knapp 30 Quadratmeter Grundfläche, ein Erkerchen, frisch renoviert. Auf Wunsch können zwei weitere Räume mit nochmal 30 Quadratmetern dazugemietet werden.
Ansonsten: weitersagen!
Schon bald wieder eine Erinnerung.

Tübingen, Februar 2012
Frühmorgens im Büro angelangt, hatte ich mit dickem Filzstift einen Zettel geschrieben und an den Monitor geklebt:
“An den Computer denken.”
Seitdem flankierte dieser Satz meinen Tag und steckte wie ein Mantra im Hirn fest. Ich musste nämlich unbedingt noch vor Weihnachten ein neues Notebook kaufen, das alte ging einfach nicht mehr. Es sollte ein 17-Zöller sein und der Monitor durfte nicht spiegeln, der Rest der Ausstattung war mir sehr egal. Auch das nötige Geld war auf dem Konto. Ich brauchte in dieser vollgestopften Vorweihnachtswoche nur eines: etwas Zeit. Aber klingelnde Telefone, dringende Mails und drängelnde Kunden hielten mich am Schreibtisch gefangen. Die Mittagspause war schon verstrichen, da – endlich – ergab sich eine gute Gelegenheit. Ich musste zur Post, der Computerladen lag gleich vis-a-vis, es war kurz vor halb drei und die nächste Besprechung um drei. Das musste einfach reichen. Um nicht vor lauter Post den Computer zu vergessen, wiederholte ich immerfort mein Mantra, während ich mich in die Schlange vor dem Postschalter einreihte.
“Ich muss an den Computer denken. Ich muss an den Computer denken. Ich muss an den Computer denken.”
Die Schlange hatte leider vorweihnachtliche Länge. Zudem mussten die Päckchen für Omi, Tante Hilde und das kleine Mäxchen umgepackt und neu verklebt werden. Auch ohne die gelbe Linie zu überschreiten, konnte ich die komplizierten Transaktionen von Herrn Papadopoulos mit der griechischen Postbank mitverfolgen und die Bemühungen des unfassbar freundlichen Schalterbeamten beobachten, einem alle Zeit der Welt habenden pensionierten Philatelisten die Vorzüge der neuen Wohlfahrtsmarken haarklein zu erläutern. Die Uhr tickte erbarmungslos. Mein Paket war in 20 Sekunden aufgegeben, und ich stürmte über die Straße ins Notebookparadies.
“Bald muss ich nicht mehr an den Computer denken“, variierte ich mein Mantra, während ich geschickt einem vergeblich rückwärts einparkenden Riesen-BMW auswich
Knapp 30 Notebooks starrten mich mit aufgeklapptem Deckel an und lächelten. Eines davon war meines. Aber welches? Im Slalom sauste ich zwischen der aufgestellten Ware durch und scannte im Vorübersausen die draufgepappten technischen Angaben. Ich hatte Glück: Nur einer der fünf 17-Zöller hatte eine matte Frontscheibe. Dem Verkäufer, der heranschlenderte, um mir etwas ganz anderes aufzuschwatzen,, schnitt ich die Rede ab, indem ich auf das Gerät zeigte und mit der EC-Karte winkte. Der Mann war gut, denn er erkannte nicht nur den Ernst der Lage, sondern auch seine Chance auf den schnellsten Umsatz aller Zeiten. Er huschte ins Lager, ließ en passant die Rechnung aus dem Drucker flutschen, zog die EC-Karte durchs Gerät, drückte mir die Tasche in die Hand und wünschte gutes Gelingen.
„Ich dachte an den Computer. Ich bin ja so ein Guter“, sang es aus mir heraus, als ich den Laden verließ. Es war zehn vor drei und ich war just in time.
Ich klatschte mir innerlich High Five, lenkte meine Schritte wieder in Richtung Büro, legte leichtfüßig weitereilend noch einen Zahn zu und fädelte mit beiden Füßen in ein auf dem Boden liegendes weißes Plastikpaketband ein, das kurz nach der Apotheke auf dem Boden lag.
Da nun meine beiden Füße fest miteinander verbunden waren, versagte das Konzept des leichtfüßigen Weitereilens. Bedingt durch die Energie der Vorwärtsbewegung einerseits und die zum Straßenbelag gerichtete Schwerkraft andererseits trat an seine Stelle das Konzept des Fallens. Des schnellen Fallens. Des verdammt schnellen Fallens. Da die linke Hand die Tasche mit dem Computer (“Computer! Ich muss an den Computer denken!”) umklammerte und die rechte, des kalten Vorweihnachtsfrostes wegen, tief in der Hosentasche steckte, ergab sich aus all diesen Komponenten, dass sich Boden und Stirn praktisch im rechten Winkel trafen, gebremst lediglich durch das, was dem Gesicht am weitesten vorsteht. Die Nase.
Kennt ihr den kurzen, harten Schmerz, der einen ereilt, wenn man auf den Boden knallt? Als Kind kannte ich ihn gut. Das Fallen von Klettergerüsten, von Pferden, von Bäumen, im Sportunterricht, vom Fahrrad – darin war ich richtig gut. Immer vorne dran, beim Ausloten der Gefahr stets an vorderster Front. Immer der erste auf dem Boden. Meine Schmerzerinnerung trügte nicht: Es war exakt dasselbe Phänomen. Das Knallgeräusch, das Gefühl sich verschiebender Hirnmasse, die Machtlosigkeit, der metallische Geschmack von Blut auf der Zunge – ich war für eine Sekunde wieder das Kind, das soeben im vollen Galopp vom Pferd gestürzt, gegen die seitliche Bande der Reithalle geknallt war und nach Luft schnappte.
Allerdings lag ich diesmal zwischen Passanten, neben einer belebten Straße, sah aus dem Augenwinkel das Logo der Post und eine davoneilende Frau. Der Schmerz wich dem Gefühl der peinlichen Situation – Was mussten die Leute denken? -, dann der spontanen Reaktion – Blute ich? Herrje, ja, schon tropfte es auf meinen Ärmel, ich beugte mich nach vorn, suchte das Taschentuch, um den Blutfluss kontrollieren zu können, spähte parallel nach Passanten, denen ich peinlich aufgefallen sein könnte – und sah auch schon jemand mit weißem Kittel aus der Apotheke auf mich zueilen. Haltung wahren, Blut stillen, Zähne zusammenbeißen, Nase kontrollieren – Autsch! – die Apothekerin anlächeln und …
“Der Computer, ich muss an den Computer denken!”
Der aber stand aufrecht, mit einer geradezu graziösen Nonchalance in seiner roten Tüte neben mir, als wolle er sagen: “Mach’s wie ich, verhalte dich unauffällig, noch hat niemand was gemerkt.” Das Gesicht der Apothekerin sagte etwas anderes. “Kann ich Ihnen helfen?” Ich ergab mich. Wenigstens eine Minute hinsitzen, die Nase hoch und kurz nachdenken, wie ich möglichst unpeinlich zurück ins Büro gelangen könnte. Ich bejahte also, dachte an den Computer, schnappte ihn und folgte der besorgt dreinblickenden Pharmazeutin ins Sitzparadies für kleine Ulis.
Immerhin hatte ich noch an den Computer gedacht. Ich hoffte, ihm ging es besser als mir.
Mein Engel deutete auf einen Stuhl hinter dem Kopfschmerztablettenständer, drückte mir ein Päckchen hochpreisige Papiertaschentücher in die Hand und bediente die nächste Kundin, die nun ihren Mund wieder zuklappen konnte. Kaum saß ich, schon spürte ich, dass noch etwas anderes nicht stimmte. Schweißperlen traten auf meine Stirn, mein Magen senkte sich ins Flaue und die ganze Apotheke nahm einen grauen Farbton an. Da ich schon mal umgekippt war, wusste ich, was das hieß: Mein Kreislauf verabschiedete sich. Ich wusste auch, was zu tun war: Hinliegen, Füße hoch, abwarten. Aber mitten in der Apotheke?
Ich wankte zur Theke und machte auf mich aufmerksam, was dank meines pastellgrünen Gesichts nicht schwer war. Eine Minute später lag ich auf einer Liege zwischen Apothekenhelferinnenmäntelchen, Apothekenhelferinnenhandtäschchen und Apothekenhelferinnenschühchen. Ich hatte irgendetwas aus blauem Plüsch unter meine Füße gestopft und spürte, wie das Blut langsam ins Hirn zurückronn.
“Der Computer! Habe ich an den Computer gedacht?”
Aber ja. Da stand er, neben der Liege. ###Ich war mittlerweile ein ausgebuffter An-den-Computer-Denker; meine Synapsen arbeiteten im Gleichklang mit dem Rückenmark an der Wiederherstellung meiner IT-Ausrüstung.### Der Hinterkopf registrierte parallel, dass die hilfreiche Pharmazeutin mittlerweile dem Telefon mitteilte, ein Mann sei umgekippt und läge nun bei Ihnen auf der Liege. “So ein Zufall”, dachte ich und überlegte noch, auf welcher Liege der andere wohl liege, als schon die Ärztin vom Stockwerk über der Apotheke in der Raum trat und flugs mein Handgelenk zwischen die Finger nahm.
Ob ich schon öfter umgekippt sei, wollte sie wissen. Während sie das Blutdruckmessgerät aufpumpte, erzählte ich ihr geduldig die Paketbandgeschichte, die sie natürlich nur glaubte, weil Puls und Blutdruck völlig normal waren. “Trotzdem müssen wir das da”, sie deutete auf meine Nase, “versorgen. Können Sie gehen?” Ich versicherte, dass nicht meine Haxen gebrochen wären, sondern allenfalls der Gesichtserker und wahrscheinlich ließ mein Gesichtsausdruck ihre zur Gehhilfe bereitgestellte Hand wieder in die Tasche zurückwandern. Ich richtete mich auf, prüfte, ob die Welt noch horizontal und vertikal ausgerichtet war und wollte gerade hinauswanken …
“Der Computer, ich muss an den Computer denken!”
Die Ärztin wich meiner Nase aus, die aprupt der Computereinkaufstasche zustrebte. “Gerade gekauft”, erklärte ich und nun ging’s ein Stockwerk höher. Die Ärztin bestand auf die Benutzung des Aufzugs, sie hatte wohl Angst, ich würde die Treppe hinabhageln. Oben angelangt, durfte ich erst einmal die Krankenkassenkarte zücken, 10 Euro berappen und meine Telefonnummer hinterlassen, auf dass die ärztliche Datenbank keine leeren Felder aufweisen möge. Die Empfangsdame legte eine Krankenakte an und druckte ungefähr hundert Formulare auf einem Farblaserdrucker aus. Man muss das deutsche Gesundheitssystem nicht verstehen, um zu begreifen, warum es so teuer ist.
 Dann ging alles schnell. Die Ärztin schnitt das weggeschobene Stück Haut mit einem Scherchen ab, pinselte irgendeine Flüssigkeit auf die Nase, legte verschiedene Schichten weißes Zeugs darauf und beendete ihr Handwerk mit einem riesigen Pflaster. Ihr Angebot, mich drei Tage krankzuschreiben, musste ich dankend ablehnen, denn erstens hatte ich ja im Moment eine Besprechung, zu der ich schließlich noch stoßen wollte, zum anderen sind Selbständigkeit und Krankschreibung zwei sich ausschließende Lebensentwürfe. Ich wurde also mit der Mahnung entlassen, bei plötzlich auftretendem Erbrechen, rasenden Kopfschmerzen oder kleineren Hirnblutungen doch lieber eine Klinik aufzusuchen. Ich nickte vorsichtig und bat um meine Entlassung.
Dann ging alles schnell. Die Ärztin schnitt das weggeschobene Stück Haut mit einem Scherchen ab, pinselte irgendeine Flüssigkeit auf die Nase, legte verschiedene Schichten weißes Zeugs darauf und beendete ihr Handwerk mit einem riesigen Pflaster. Ihr Angebot, mich drei Tage krankzuschreiben, musste ich dankend ablehnen, denn erstens hatte ich ja im Moment eine Besprechung, zu der ich schließlich noch stoßen wollte, zum anderen sind Selbständigkeit und Krankschreibung zwei sich ausschließende Lebensentwürfe. Ich wurde also mit der Mahnung entlassen, bei plötzlich auftretendem Erbrechen, rasenden Kopfschmerzen oder kleineren Hirnblutungen doch lieber eine Klinik aufzusuchen. Ich nickte vorsichtig und bat um meine Entlassung.
Der Nachhauseweg war davon geprägt, möglichst wenig Bekannte zu treffen, was in einer Stadt, in der man seit dreißig Jahren zuhause ist, dazu führt, dass man mehrmals den Bürgersteig wechseln muss. Den fragenden Blicken der anderen Passanten wich ich so geschickt aus, wie das unter diesen Umständen möglich war, also nicht. Zur Besprechung kam ich eine Stunde zu spät, aber sie hatte auch noch gar nicht angefangen. Aber das war mir sowieso egal, denn kaum angelangt, entfuhr mir ein wilder Fluch.
Ich hatte den Computer vergessen.
Als ich neulich in den Buchladen ging, um ein Buch zu kaufen, das ich nun lieber wieder zurückgäbe, fiel mir folgendes ins Auge:

Worauf ich nähertrat, …

… in Erstaunen ausbrach …

… und schließlich in Kaufaktion trat:

Sollte Roman Held alias @hoch21 jemals wieder bei uns lesen, dann kriegt er das Schoklädle als Nachtisch. Versprochen.
[Dem Alex sein digitales Universum hat’s zuerst gefunden, dabei fand dieser schöne Flashmob schon am 1. Advent im Tübinger Kaufhaus Zinser statt.]
 Wie schon vor vier Jahren angekündigt, besuche ich nächste Woche die re:publica. Wer nicht weiß, was das ist, sollte sich schämen oder nachlesen. Alle anderen mögen darüber nachdenken, ob sie schon ein Ticket haben. Wenn nein: Zu spät! Wenn ja: Ich suche noch Mitreisende. Anders formuliert: Ich suche oder biete eine Mitfahrgelegenheit von Tübingen/Stuttgart nach Berlin (12. oder 13. hin, 15. zurück). Interessebekundungen bitte in die Kommentare oder direkt per Mail. Danke.
Wie schon vor vier Jahren angekündigt, besuche ich nächste Woche die re:publica. Wer nicht weiß, was das ist, sollte sich schämen oder nachlesen. Alle anderen mögen darüber nachdenken, ob sie schon ein Ticket haben. Wenn nein: Zu spät! Wenn ja: Ich suche noch Mitreisende. Anders formuliert: Ich suche oder biete eine Mitfahrgelegenheit von Tübingen/Stuttgart nach Berlin (12. oder 13. hin, 15. zurück). Interessebekundungen bitte in die Kommentare oder direkt per Mail. Danke.

Harry Kienzler

Werner Schärdel

Maximilian Liesner

Anna B.

Patrick Seitz

Christoph Knüser
Nachdem dieser einen Schierlingsbecher samt Theaterfreikarten in Empfang nehmen durfte und auch die anderen Vortragenden mit warmem Applaus verabschiedet worden waren, war der Philo-Slam nach einer guten, kurzweiligen und sinnträchtigen Stunde auch schon wieder am Ende. Meine Verblüffung darüber war so groß, dass ich erst auf der Heimatfahrt merkte, dass in den angebrochenen Abend noch gut und gerne ein Feierabendbier mit meinem Nebensitzer gepasst hätte. Das holen wir nächstes Mal aber nach, Helmut!
Nachtrag 7.12.
Christoph Knüser heißt in wirklich Christoph Knüsel. Das erklärt manches, vor allem aber, dass ich ihn im Netz nicht fand.